
Bildschöne Wortspiele im Unterricht
Die Bildkarten der Spielesammlung Bildschöne Wortspiele regen zu Assoziationen an. In den Spielen geht es darum, die Assoziationen in Worte zu fassen. Dabei werden Sprachkompetenz und Kreativität gefördert.
Wortbildung – Komposita
![]() Diminutivformen
Diminutivformen
 +
+  = Fußkettchen
= Fußkettchen
![]() Substantiv-
und Verbbildung
Substantiv-
und Verbbildung
 +
+  =
Kopfsprung
=
Kopfsprung
 +
+  =
ablaufen
=
ablaufen
Semantik
![]() Synonymbildung
Synonymbildung



Meer – See Gang
- Flur Himmel
- Jenseits
![]() Hierarchisierung/Abstraktion
Hierarchisierung/Abstraktion



Apfel, Obst, Frucht Tulpen,
Blumen, Pflanzen Adler, Vogel, Tier
![]() Themenfelder
Themenfelder


Paar Erde
, Globus, Welt
Zuneigung Landkarte,
Atlas
Liebe Staaten,
Länder, Regionen
Stil
![]() „Hochsprache“ /
Umgangssprache
„Hochsprache“ /
Umgangssprache
 +
+
 =
Autobahn / Autozug
=
Autobahn / Autozug
 +
+  = Obstkarre
/ Obstkiste
= Obstkarre
/ Obstkiste
Sprachliche Kreativität
 +
+  +
+ =
Abwrackprämie
=
Abwrackprämie
 +
+  =
Hühnerfutter
=
Hühnerfutter
 +
+  +
+  =
Menschenauflauf
=
Menschenauflauf
 +
+  =
Kopf-an-Kopf-Rennen
=
Kopf-an-Kopf-Rennen
Aktivierung
![]() Wer passt
zu mir?
Wer passt
zu mir?
Bewegung: Jedes Kind erhält eine Karte und stellt
sich im Zimmer mit einem Abstand zu den anderen Kindern auf. Alle Kinder
schauen sich gut ihre Bildkarte an. Sonja fängt an und ruft: „Was
passt zu Ball?“ Mick hat die Karte ‚Kopf’ und ruft „Kopf“.
Sonja bestätigt mit „Kopfball“, Mick darf zu ihr laufen
und sich neben sie stellen. Nun ist Mick an der Reihe usw. Auf diese
Weise wird gespielt, bis alle Kinder eine Kette bilden. Wenn es dabei
Probleme gibt, weil Wortbildungen nicht klappen, können die Kinder
je nach Alter oder Zusammensetzung der Gruppe das Problem
alleine oder mit Unterstützung lösen. Andere Kinder dürfen
helfen.
Erzählen
Anhand der Fotos werden spontan Geschichten entwickelt.
Dabei soll jedes
Kind zu Wort kommen können. Je nach Zusammensetzung der Gruppe kann
mit mehreren Karten gleichzeitig oder reihum gespielt werden. Es können
auch mehrere Gruppen gebildet werden, die anschließend einander die
jeweils entwickelte eigene Geschichte nacherzählen.
Wissensbildung
![]() Quizspiel
Quizspiel
Es werden
Teams gebildet. Jedes Team erhält eine bestimmte Zahl von Bildkarten.
Die Teams entwickeln Fragen und Antworten zu ihren Karten.
Anschließend
stellen sich die Teams gegenseitig ihre Fragen. Das Team, das richtig
antwortet oder rät, bekommt die entsprechende Bildkarte als Siegpunkt.
Es gewinnt das Team, das am Ende die meisten Bildkarten hat. Hilfsmittel,
wie z.B. Lexika, sind erlaubt.
Beispiel: 
Wie kommt es, dass Eisen rostet? Wie heißt der „Rost“ bei Kupfer? Unterschied zwischen Eisen und Stahl?
Übergeordnete Lernziele
Einordnung der Motive in die eigene Lebenswelt. Beispiel: Was ist „normal“ im Sinne von alltäglich, was ist ausgefallen/besonders (z.B. die Bank, an der Räder statt Beine montiert sind).
Induktion und Deduktion. Beispiele: Wozu mag die Leiter gehören? Was wird denn da gebaut: Ein kleines Haus oder ein großes? Warum ist in dem Tor eine kleine Tür? Wozu gehört wohl der Motor?
Schulung von Beobachtung und Entscheidungsfindung: Was ist wichtig in dem Bild und warum?
Zur Konzeption der Spiele
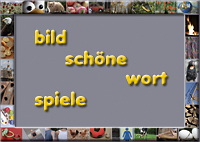 Bilder statt Schrift
Bilder statt Schrift
Bei den Spielen wird bewusst auf die Verwendung von Schrift verzichtet. Blockierungen, wie sie von der schriftgestützten Sprachvermittlung her bekannt sind, wird dadurch vorgebeugt.
Fotografien als Anreize für Assoziationen
Bereits in den ersten Testrunden, die wir wechselweise mit gezeichneten Bildern und mit Fotografien spielten, zeigte sich, dass die SpielerInnen die Fotografien gegenüber den gezeichneten Bildern deutlich bevorzugten. Überraschenderweise traf dies für alle Altersgruppen zu. Die SpielerInnen entdeckten auf den Fotos einfach mehr Dinge. Sie fanden Fotos authentischer und fühlten sich von ihnen mehr angesprochen. Aus diesen Beobachtungen heraus verwendeten wir Fotomotive als Grundlage für die Spiele.
Motivwahl und Freude am Entdecken
Die Auswahl der Motive erfolgte nach linguistischen und ästhetischen Kriterien sowie nach Akzeptanz in den Testrunden. Getestet wurde in allen Altersstufen, und zwar sowohl in altersmäßig homogen als auch heterogen zusammengesetzten Gruppen. Die Motivauswahl wurde während der gesamten Testzeit von über einem Jahr anhand der Ergebnisse ständig modifiziert.
Linguistische Orientierungen boten Klassifikationen, wie sie Lehrplänen für den Schulunterricht zu Grunde liegen, sowie sprachwissenschaftliche Häufigkeitsanalysen. Zunächst hat der Grundwortschatz besondere Berücksichtigung erfahren. Die Fotos beinhalten jedoch ein Assoziationspotenzial, das Wortbildungen über alle Sprach- und Stilbereiche hinweg ermöglicht und dazu anregt. Dadurch lassen sich Übungen sowohl zum Grundwortschatz als auch zum erweiterten Wortschatz und bis hinein in Fachsprachen durchführen. Insgesamt lassen sich weit über 3000 Begriffe mit den Motiven bilden.
Neben den Motiven vermittelt die Perspektive der Aufnahmen Impulse. Durch die Perspektivenwahl werden die abgebildeten Dinge inszeniert, manchmal leicht verrätselt. Vor allem Kinder „entdecken“ in den Fotos Bestandteile der Welt (neu), teilen sich darüber mit und tauschen sich mit den anderen aus.